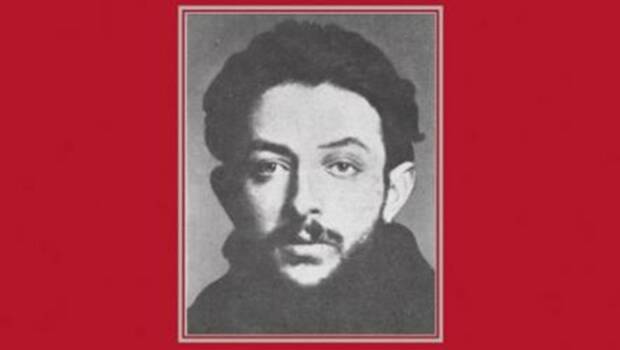
«Wir Kommunisten sind alle Tote auf Urlaub» (S. 74), lautet die wohl bekannteste geflügelte Äußerung Eugen Levinés. Er soll sie vor dem Münchner Sondergericht getätigt haben, das ihn zum Tode verurteilte, weil er als Rädelsführer der zweiten Münchner Räterepublik galt. Am 5. Juni 1919 wurde er in München-Stadelheim erschossen. Schon recht bald nach seinem Tod wurde ihm eine erste kurze Biografie gewidmet. Unter seinem Decknamen «P. Werner» publizierte der damalige KPD-Reichstagsabgeordnete Paul Frölich 1922 ein Werk, das er mithilfe von Nachlassmaterial, auf Basis persönlicher Gespräche und dank der Auskünfte von Levinés Witwe Rosa verfassen konnte.[1] Rosa Meyer-Leviné war es schließlich, die 1972 eine zweite Biografie über ihren ersten Mann verfasste.[2]
Wenngleich Frölich als autodidaktischer Historiker gilt und Meyer-Levinés persönliche Erinnerungen ihrem Werk eine plastische Authentizität einhauchen, so ist die erste geschichtswissenschaftliche Biografie über Eugen Leviné erst 2017 erschienen. Christian Dietrich hat dazu nicht nur auf die zentrale Sekundärliteratur rekurriert, sondern auch Archivalien gesichtet, die auf diese Weise erstmals zur Auswertung kamen. Er konsultierte unterschiedlichstes Material aus dem Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde, ferner dem Universitätsarchiv Heidelberg, wo Leviné studiert hatte, sowie der Prozessakte, die heute im Staatsarchiv München aufbewahrt wird.
Dietrich schreibt, Leviné sei «einhundert Jahre nach seinem Tod kein unbekannter, wenngleich ein wenig beachteter Protagonist der Arbeiterbewegung» (S. 7). Weniger bekannt ist vermutlich die Selbstwahrnehmung seiner jüdischen Identität, der sich Dietrich ebenfalls widmet (S. 10 f.). Die Geschichte des Judentums in Europa ist leider auch stets eine Geschichte der Ausgrenzung und – aus jüdischer Perspektive – eine Geschichte der Erfahrung dieser Randstellung. So erfuhr Leviné bereits als Kind in der Schule unterschiedliche Nachteile, weil er Jude war. Um diese Wahrnehmung zu dokumentieren, lässt Dietrich durch längere Quellenausschnitte immer wieder die historischen Persönlichkeiten selbst zu Wort kommen.
Levinés Vater Julius starb 1886, als Eugen noch ein kleines Kind war. Zu seiner Mutter Rosalia Leviné, geb. Goldberg hatte er «seit früher Kindheit ein wenig vertrautes Verhältnis» (S. 19), da sie ihre Kinder mit Körperstrafen zu disziplinieren gewohnt war. Als sie starb, hinterließ sie Eugen und seiner drei Jahre älteren Schwester Sonja ein beachtliches Vermögen, durch das ihnen ein sorgenfreies Leben ermöglicht wurde. So erstaunt es, wie Leviné mit den Worten Paul Frölichs die damalige Gesellschaft wahrnahm: «Er sah das üppige Leben seiner Klasse, ihr Taumeln von Genuß zu Genuß, ihren Hochmut, ihre gedankenlose Grausamkeit den Armen gegenüber; und er empfand mit den unterdrückten, von der Arbeit zermürbten, freudlos sich durch ihr Leben schleppenden Proletarierkindern» (S. 18). Nach seinem Wegzug von Petersburg nach Wiesbaden, wo er ab 1899 das Gymnasium besuchte, und einem Wechsel an das Großherzogliche Gymnasium in Heidelberg 1901 legte er dort 1903 das Abitur ab. 1913 schloss er in Heidelberg ein Studium der Staatswissenschaften ab.
Etwa ab 1903 stand Leviné den Sozialrevolutionären in Russland nahe, wandte sich im Kontext der Revolution von 1905 von der damit einhergehenden Gewaltfrage ab: «Leichten Herzens waren sie zu Terroristen geworden, ohne Zögern, ohne Bedenken» (S. 21). Trotzdem unterbrach er 1905 sein Studium, kehrte nach Petersburg zurück und beteiligte sich an revolutionären Umsturzversuchen. Der Zarismus hatte es ihm bis 1908 mit drei Gefängnisstrafen gedankt, wovon die letzte am schlimmsten ausfiel. Seine Mutter zahlte schließlich die Kaution, wodurch er wieder freikam. «Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Studienjahre die wichtigste Zeit in der politischen Sozialisation sind», bilanziert Dietrich (S. 26).
Neben der Promotion unternahm Leviné mehrere Forschungsreisen, zum Beispiel nach Belgien und in die Niederlande, und unterrichtete Russisch an der Universität Heidelberg. 1909 war er Mitglied der SPD geworden. Den Funktionären stand er zwar weitgehend distanziert gegenüber, aber im Mannheimer «Marxklub» engagierte er sich umso intensiver, beispielsweise durch Vorträge. Mit Beginn des Ersten Weltkrieges nahm er einen ungekannten kriegerischen Nationalismus wahr, der sich sowohl im akademischen Milieu seiner Heidelberger Universität spürbar machte als auch in der sozialdemokratischen Arbeiterschaft Mannheims, mit der Leviné durch eigene Berufstätigkeit während des Studiums verbunden war.
Durch intensive Studien zum Pazifismus wurde Leviné «eine Stimme des Friedens im Ersten Weltkrieg» (S. 40). Das konnte jedoch nicht verhindern, dass auch er – wie viele andere Kriegsgegner – zum Militärdienst eingezogen wurde. Im letzten Moment, bevor er an die Front versetzt werden konnte, wurde er aufgrund einer Krankheit dienstunfähig geschrieben. Seine politische Radikalisierung erfolgte nicht wie bei vielen Genossinnen und Genossen im Deutschen Reich über den Spartakusbund oder eine Gruppe der Linksradikalen, sondern sehr atypisch: Im Frühjahr 1918 fand er eine Anstellung bei der russischen Botschaft in Berlin und kam dabei auch mit den Ideen der Bolschewiki in Berührung: «Damit setzte sein Interesse für das Rätesystem und für die in Russland gemachten Erfahrungen ein» (S. 45).
Das letzte Halbjahr in der Vita Levinés, das den größten Bekanntheitsgrad erlangte, nimmt auch in Dietrichs Buch einen großen Teil ein, immerhin gut die zweite Hälfte. Doch da dieser Teil der Biografie bereits bekannter ist, sei hier abschließend nur auf den Untertitel des Buches eingegangen: «Ich fühle russisch und denke jüdisch.» Dank seines Vaters hatte Leviné die italienische Staatsbürgerschaft, in der Familie wurde zudem fließend deutsch gesprochen. Politisch gesehen war Leviné Internationalist, doch womöglich drängte ihn die gesellschaftliche Ausgrenzung in eine russisch-jüdische Identität. Im Gerichtsprozess urteilte man: «Leviné war ein Eindringling in Bayern» (S. 72). Mit diesem Vorwurf war er während der ganzen Zeit der Räterepublik wiederholt konfrontiert worden. Was den Stellenwert des Judentums angeht, so ist Leviné wie so viele Revolutionäre und mit den Worten Isaac Deutschers wohl eher ein «nichtjüdischer Jude» gewesen.[3] Die Religion spielte kaum eine Rolle, die Kultur hingegen eine große. Den Antisemiten war dieser Umstand einerlei.
Dietrichs Biografie liefert eine kurzweilige, aber detailverliebte Lebensbeschreibung einer Persönlichkeit, die zwar primär für das letzte Halbjahr ihres kurzen Lebens berühmt wurde, doch auch zuvor schon einen fesselnden Weg hinter sich gebracht hatte.
[1] Vgl. P. Werner: Eugen Leviné, Berlin 1922.
[2] Vgl. Rosa Meyer-Leviné: Leviné. Leben und Tod eines Revolutionärs. Erinnerungen, München 1972. Ferner Rosa Meyer-Leviné: Leviné: The life of a revolutionary, Farnborough 1973.
[3] Vgl. Isaac Deutscher: The Non-Jewish Jew, Vortrag von 1958.
Christian Dietrich: Eugen Leviné. „Ich fühle russisch und denke jüdisch“, Berlin 2017: Hentrich&Hentrich (= Jüdische Miniaturen, Bd. 209, 82 S., 8,90 €).
