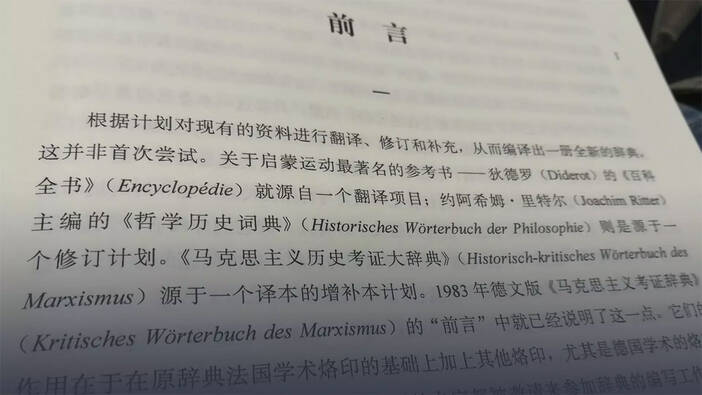Das Historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus (HKWM) ist ein marxistisches Lexikon, das nach seiner Fertigstellung 15 Bände und über 1.500 Einträge umfassen wird. Von den bisher erschienenen neun Bänden in deutscher Sprache sind seit 2017 zwei Bände in chinesischer Sprache herausgegeben worden. Im Frühjahr 2019 hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung gemeinsam mit dem HKWM-Team die «Internationalisierung» des Lexikons auf Englisch und Spanisch vorangetrieben, um eine neue Generation marxistischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt für das Projekt zu gewinnen und seine Leserschaft und Reichweite zu vergrößern. Der unten stehende Eintrag ist Teil einer Auswahl dieser Übersetzungen, die auf unserer Website zur Verfügung gestellt werden.
Weitere Informationen über das Projekt und andere übersetzte Lexikon-Einträge finden sich in unserem HKWM-Dossier.
A: iḍrāb al-ǧamāhīr. – E: mass strike. – F: grève de masse. – R: massovaja stačka. – S: huelga de masas. – C: qúnzhòng bàgōng 群众罢工
I.
Bei der M-Debatte Anfang des 20. Jh. geht es im Kern um das Verhältnis des Ökonomischen zum Politischen, um das von Partei und Gewerkschaften, um Arbeiterbewegungspolitik, um die Problematik des M als politisches Mittel, als Kampfmittel zur Vorbereitung von Revolution oder als Erscheinungsform des proletarischen Kampfes in der Revolution. Ein zentraler historischer Bezugspunkt ist die Rolle des M in der russischen Revolution von 1905, die Lenin – einschließlich des historischen Verlaufs der Protestformen der ›Intelligenz‹ und der Arbeiter – eingehend analysiert. Rosa Luxemburg verfasst grundlegende Schriften zum M sowie zahlreiche Reden und Artikel zu M.s in Belgien, Frankreich, Holland, Italien, Österreich, Schweden, Spanien, den USA, die die internationale Bandbreite und politische Präsenz ihrer Agitation und ihre politische Orientierung zeigen. Der Schwerpunkt liegt im Folgenden nicht auf der Nachzeichnung der unterschiedlichen Flügel innerhalb der Sozialdemokratie (August Bebel, Wilhelm Liebknecht, Luxemburg, später Karl Kautsky), sondern auf dem Begreifen des M bei Lenin und v.a. bei Luxemburg, also der Weise ihres marxistischen dialektischen Denkens. Dieses macht den Streit relevant für die Kämpfe und das Spannungs- oder auch Trennungsverhältnis von Partei, Bewegung und Gewerkschaften. Die Fragen werden in den Debatten um Krise und Transformation nach 2008 auf globalem Maßstab wieder aktuell. 1. Die Debatte um den M kennzeichnet die Flügelkämpfe, die innerhalb der Sozialdemokratie Deutschlands (als Kopf des internationalen Sozialismus) an der Wende vom 19. zum 20. Jh. fast zwei Jahrzehnte lang geführt werden. Entsprechend spiegeln sich in der Entwicklung der sozialdemokratischen Taktik und Strategie die Kämpfe um den M, namentlich den Generalstreik. Auf den Parteitagen von 1893 (Köln) und 1906 (Mannheim) werden Leitlinien festgehalten.
Wilhelm Liebknecht erteilt dem Generalstreik als politisches Mittel 1893 eine allgemeine Absage; und 1906 einigen sich Partei und Gewerkschaften auf »Frieden und Eintracht« und daher auf eine Absage an offensiven politischen M und eine Neupositionierung ihrer jeweiligen, aufgrund ihres Wachstums gewichtiger werdenden Rollen. Luxemburg greift wiederholt kritisch in die Debatte ein.
In Belgien entscheidet der Generalrat der Arbeiterpartei 1902, den M zur Erlangung des allgemeinen Stimmrechts abzubrechen, was nach heftiger Kontroverse auf dem anschließenden Parteitag gebilligt wird. Der Grund für den Abbruch war, dass die Liberalen (Kapitalisten), die den Kampf fürs allgemeine Wahlrecht zunächst unterstützt hatten, den neuen Streik nicht mittrugen, sondern sich den Klerikalen anschlossen, weil es nicht nur um den Zutritt zur Kammer ging wie im erfolgreichen Generalstreik von 1893, sondern mit gleichem Wahlrecht der Weg zur politischen Herrschaft des Proletariats gebahnt schien. In dieser neuen Konstellation stimmen die Sozialisten, von den Liberalen verraten, dem Abbruch des Generalstreiks zu. Luxemburg legt 1902 insbesondere gegen den anarchistischen Flügel, der den Generalstreik unbedingt als erfolgreiches Mittel zugleich für die Erreichung politischer Ziele im Kleinen und der großen Umwälzung behauptet, noch einmal die wissenschaftliche Methode der Zustimmung oder Ablehnung dar, die sich auf das jeweilige konkrete Studium des Ortes, der Zeit und des Nationalen oder Internationalen der organischen Verbindung des politischen Klassenkampfes mit den konkreten alltäglichen gewerkschaftlichen Kämpfen bezieht (vgl. GW 1/2, 235). Kautsky empfiehlt ihre Position in diesem Streit unter ausführlichem Zitieren aus ihren Reden als klarsichtig und orientierend (Der politische Massenstreik, Berlin 1914, Kap. 10).
Angesichts der Auseinandersetzung um den belgischen M fürs Stimmrecht plädiert Luxemburg für die genaue Analyse, da »jedes Schablonisieren und summarische Ablehnen oder Verherrlichen dieser Waffe« eine »Gedankenlosigkeit« sei (GW 1/2, 234). In der Hauptsache streitet sie einerseits gegen die anarchistische Vorstellung der Vorbereitung der Revolution durch Generalstreiks, andererseits gegen die Preisgabe aller Utopie und die völlige Ablehnung des Generalstreiks, der wegen seiner politischen Effekte »lokal und gelegentlich« (236) für die sozialistische Agitation wichtig bleibe. Wesentliche Kriterien dafür seien die historische und politische Einbettung, die »Verwachsung« (238) von Partei und Gewerkschaft, der Grad der Industrialisierung und Zentralisierung eines Landes.
Vier Jahre später, nach der ersten russischen Revolution von 1905, beurteilt Luxemburg die Debatten über den M im internationalen Sozialismus als »antiquiert«, weil sie von Vorstellungen aus der Zeit vor »dem ersten geschichtlichen Experiment mit diesem Kampfmittel auf größter Skala« (Mass, 93) ausgingen und daher nicht über Engels’ spöttische Verurteilung der »anarchistischen Theorie […] vom Generalstreik als Mittel, die soziale Revolution einzuleiten, im Gegensatz zum täglichen politischen Kampf der Arbeiterklasse« (94) hinausgelangten. Luxemburg schlägt eine Revision der sozialdemokratischen Linie der Arbeiterbewegung auf Grundlage des konkreten Studiums der russischen Revolution vor, in der der M gerade nicht als auslösender »Theatercoup«, sondern als »ein Mittel, erst die Bedingungen des täglichen politischen Kampfes und insbesondere des Parlamentarismus für das Proletariat zu schaffen« (96), erscheint. Folglich habe »die geschichtliche Dialektik, der Fels, auf dem die ganze Lehre des Marxschen Sozialismus beruht, es mit sich gebracht, dass heute der Anarchismus, mit dem die Idee des M unzertrennlich verknüpft war, zu der Praxis des M selbst in einen Gegensatz geraten ist, während umgekehrt der M, der als der Gegensatz zur politischen Betätigung des Proletariats bekämpft wurde, heute als die mächtigste Waffe des politischen Kampfes um politische Rechte erscheint« (97).
Die Trennung des Ökonomischen vom Politischen führt Luxemburg zufolge zu theoretischem Streit um das Nacheinander der Kämpfe und den jeweiligen Rang, diese Betrachtungsweise aber sei »abstrakt« und »unhistorisch« (ebd.), verfehle das wirkliche Leben bzw. nehme es nicht zur Kenntnis. Was ökonomisch, was politisch ist, ändere sich beim Machen, und damit würden auch die Akteure sowie das Verhältnis von Ziel und Mittel verändert. Luxemburg verbindet schon zu Beginn die Debatte mit einem praktischen Forschungsauftrag: »Nicht durch abstrakte Spekulationen […] über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit, den Nutzen oder die Schädlichkeit des M, […] sondern durch die Erforschung derjenigen Momente und derjenigen sozialen Verhältnisse, aus denen der M in der gegenwärtigen Phase des Klassenkampfes erwächst […], kann das Problem allein erfasst und auch diskutiert werden.« (100)
Luxemburg skizziert einen möglichen Ablauf: Es gibt einen Anlass, ein Ereignis – jemand wird entlassen, es gibt einen Unfall, einen Zwangsurlaub ohne Lohn zur Krönung des Zaren; es folgt ein Streik – er kann zunächst ökonomisch sein, schlägt ab einem gewissen Punkt um ins Politische (104), weil die Leiderfahrungen der Klasse immer bewusster werden. Bewusstsein und Schulung, mehr Wissen machen aus einem ökonomischen einen politischen Streik. Weder Revolution noch M könne man propagieren, sie seien »Begriffe, die selbst bloß eine äußere Form des Klassenkampfes bedeuten, die nur im Zusammenhang mit ganz bestimmten politischen Situationen Sinn und Inhalt haben« (100). Der M »ist nicht ein pfiffiges Mittel, ausgeklügelt zum Zwecke einer kräftigeren Wirkung des proletarischen Kampfes, sondern er ist die Bewegungsweise der proletarischen Masse, die Erscheinungsform des proletarischen Kampfes in der Revolution« (125).
2. Gewiss übernimmt Luxemburg Einschätzungen Lenins. Er beschreibt den Beginn der russischen Revolution von 1905 als eine Art Lernprozess von revolutionärer Intelligenz und sich auflehnenden Arbeitern. Er notiert, wie im Zuge der Streikbewegung Ende der 1890er Jahre binnen kurzer Zeit »beinah die ganze revolutionäre Intelligenz« sozialdemokratisch wird (Feb. 1905, LW 8, 128). Die sozialdemokratische Partei wird 1898 gegründet. Die um 1900 beginnende Demonstrationsbewegung wird zunächst mehrheitlich von Studenten getragen, denen die Arbeiter zu Hilfe eilen. In den von Streiks erfassten Gebieten und Städten, an denen sich 1903 »mehr als hunderttausend Arbeiter« beteiligen, werden wiederholt »politische Massenversammlungen« abgehalten (ebd.). »Man spürt, dass wir am Vorabend von Barrikadenkämpfen stehen […]. Der Vorabend erweist sich jedoch als verhältnismäßig lang, als ob er uns lehren wollte, dass mächtige Klassen ihre Kräfte mitunter monate- und jahrelang sammeln, als ob er die kleingläubigen Intellektuellen, die sich der Sozialdemokratie angeschlossen haben, auf die Probe stellen wollte.« (Ebd.) Den Beginn der Revolution fasst er gleichwohl als Ausbruch wie bei einem Vulkan: »Die proletarische Bewegung erhob sich mit einem Schlag auf eine ihrer höchsten Stufen« und »der Streik und die Demonstration begannen sich […] zum Aufstand zu entwickeln. Die Beteiligung der organisierten revolutionären Sozialdemokratie war unvergleichlich stärker als in den vorhergegangenen Stadien der Bewegung, aber immer noch zu schwach […] im Vergleich zu dem gigantischen Bedürfnis der aktiven proletarischen Masse nach sozialdemokratischer Führung.« (129)
Unter dem Titel Politischer Streik und Straßenkampf in Moskau (Okt. 1905) notiert Lenin eine Verschiebung der bestimmenden Kräfte: »Die Arbeiterbewegung hat der ganzen russischen Revolution ihren Stempel aufgedrückt. Mit vereinzelten Streiks beginnend, entwickelte sie sich rasch einerseits bis zu M.s, anderseits bis zu Straßendemonstrationen. Im Jahre 1905 erscheint der politische Streik bereits als voll entwickelte Form der Bewegung und schlägt […] in den Aufstand um«, mitunter »binnen wenigen Tagen vom einfachen Streik zum gigantischen revolutionären Ausbruch« (LW 9, 346). Lenin erfasst mit knappen Worten, wie der Streik von einer theoretisch diskutierten Möglichkeit zu einer realen Bewegung wird, die das Leben der Menschen ergreift: »Das unvermeidliche Hinausgehen der Arbeiter auf die Straße […] verwandelt sich in eine politische Demonstration«; revolutionäre Lieder werden gesungen, und »die lange zurückgehaltene Erbitterung über die niederträchtige Komödie der ›Volks‹wahlen zur Reichsduma kommt zum Durchbruch. Der M geht über in eine Massenmobilmachung der Kämpfer für die wahre Freiheit.« (Ebd.) Schließlich verweist Lenin auf die internationale Bedeutung der russischen Erfahrungen; so sei der politische M die Hauptfrage des Jenaer Parteitags der deutschen Sozialdemokratie (1905) geworden.
Da der »bewaffnete Aufstand« die »Hauptform« des Kampfes des sich herausbildenden Proletariats sei, betrachtet Lenin Streiks gewissermaßen als Hilfsmittel, deren Zeitpunkt jener Hauptform unterzuordnen sei (LW 10, 145; 11, 157). An zwei Stellen versucht er sich an einer Art Systematik der Abfolge historischer Streiks und ihrer Entwicklung. Zuerst habe es »wirtschaftliche Streiks der Arbeiter (1896 bis 1900)« gegeben, dann »politische Demonstrationen der Arbeiter und Studenten (1901 und 1902), Bauernunruhen (1902)«, dann 1903 erstmals »politische M.s«, 1905 den Generalstreik in ganz Russland mit Barrikaden und »Teilaufständen der Bauern« (LW 11, 204). Lenin notiert 1913, als Losungen der politischen Streiks »müssen mit verstärkter Energie die revolutionären Grundforderungen der Gegenwart verbreitet werden: demokratische Republik, Achtstundentag, Konfiskation der Gutsbesitzerländereien « (LW 19, 414). Im Januar 1917 durchdenkt er, rückblickend auf 1905, den Übergang zur Revolution: »Hunderte revolutionäre Sozialdemokraten wuchsen […] zu Tausenden an, Tausende wurden zu Führern von 2 bis 3 Millionen Proletariern. Der proletarische Kampf erzeugte eine große Gärung, teilweise eine revolutionäre Bewegung, innerhalb der Masse von 50 bis 100 Millionen Bauern, die Bauernbewegung erzeugte Sympathie im Heere und führte zu Militäraufständen […]. So geriet das ungeheure Land mit 130 Millionen Einwohnern in die Revolution, so ist aus dem schlafenden Russland das Russland des revolutionären Proletariats und des revolutionären Volkes entstanden.« (LW 23, 246)
Diesen Übergang gilt es zu begreifen. Das Studium der Streikstatistiken hält Lenin dabei für unerlässlich. Die russische Revolution von 1905 »ist die erste […] große Revolution in der Weltgeschichte […], in der der politische M eine ungemein große Rolle spielte«, und man könne »den Wechsel ihrer politischen Formen [nicht] verstehen, ohne die Grundlage […] dieses Wechsels in der Statistik der Streiks zu suchen« (247).
3. Luxemburg spitzt Lenins Formulierungen anders zu, ohne ihnen explizit zu widersprechen. Da der M eine Form sei, die der Kampf annehme, sei er eben nicht wählbares Mittel, könne nicht geplant und nach Absicht eingesetzt werden, sondern sei selbst Produkt. Er sei nicht »Einzelhandlung«, sondern »der Sammelbegriff einer […] vielleicht jahrzehntelangen Periode des Klassenkampfes« (Mass, 125). Ein nach Plan und Absicht verlaufender Streik sei hingegen der politische Demonstrationsstreik (etwa die Maifeier), »eine untergeordnete Spielart« (127), die mit dem »Wachstum des politischen Bewusstseins und der Schulung des Proletariats« unmöglich werde (126). In ihrem Antrag zum politischen Massenstreik auf dem Magdeburger Parteitag 1910 erinnert sie an die vielen Demonstrationsstreiks in den Wahlrechtskämpfen und an eine stärkere Waffe, »die Arbeitsverweigerung, der politische M« (GW 2, 459). Der historische Augenblick sei weder vorhersehbar noch herbeiführbar, der scheinbare Stillstand enthalte alle Momente: Lohnkampf, Kampf um die Arbeitszeit, Schikanen und schließlich einen Faktor, der das Fass zum Überlaufen bringt. So habe »der Konflikt der zwei gemaßregelten Putilow-Arbeiter […] sich binnen einer Woche in den Prolog der gewaltigsten Revolution der Neuzeit verwandelt« (Mass, 110).
Luxemburg nennt Generalstreik den gewerkschaftlich geplanten Streik und spricht von M, wenn eine spontane Zusammenführung vieler Kämpfe und Massen von Arbeitern gemeint ist, bestimmt durch »die Reife der historischen und wirtschaftlichen Bedingungen« (GW 2, 460). Wie Lenin folgert sie aus der wirklichen Geschichte, dass zwischen ökonomischen und politischen Kämpfen »eine völlige Wechselwirkung« besteht, sie nur »zwei ineinandergeschlungene Seiten des proletarischen Klassenkampfes « seien, den sie den »Kriegszustand der Arbeiter mit dem Kapital« nennt (Mass, 128). »Der ökonomische Kampf ist das Fortleitende von einem politischen Knotenpunkt zum andern, der politische Kampf ist die periodische Befruchtung des Bodens für den ökonomischen Kampf.« (Ebd.)
Mit Ausdrücken wie »zufällig« und »elementar« kann Luxemburg die Dynamik zugleich als Ergebnis politischer Bildungsarbeit wie als unvorhersehbar charakterisieren; worauf ein Ereignis treffe, seien »Früchte der mehrjährigen Agitation« (104), und so kann sie das Ziel, die »tiefgehende innere Umwälzung in den sozialen Klassenverhältnissen« (129), als Perspektive festhalten, ohne das genaue Wie von oben zu dekretieren. Hier werden neben den Übereinstimmungen die Unterschiede zu Lenins Position deutlich. So weit und unbestimmt Luxemburg das Feld des Möglichen öffnet, so bestimmt sind ihre Verurteilungen vorschneller Verallgemeinerungen, wie sie die Debatte um den M bestimmen. Der M ist kein »Taschenmesser, das man […] nach Beschluss aufklappen und gebrauchen kann« (Mass, 98), und den M zum »Gegenstand einer regelrechten Agitation zu machen« ist ebenso »abgeschmackt« wie für »die Idee der Revolution oder des Barrikadenkampfes « zu agitieren (100). Stattdessen schlägt Luxemburg vor, »den geistigen Horizont des Proletariats zu erweitern, sein Klassenbewusstsein zu schärfen, seine Denkweise zu vertiefen und seine Tatkraft zu stählen« (101) durch politische Bildung, durch Analyse der Kämpfe, dass die Arbeitenden allesamt immerzu informiert, in Diskussionen verwickelt, ins Lernen gebracht werden, damit sie bewusst handeln. In ihrer Rede vor Metallarbeitern in Hagen 1910 – es geht um die drohende Aussperrung von 400 000 Arbeitern – nennt sie die Arbeiterbewegung ein »Kulturwerk«, weil »die gewaltige Masse des arbeitenden Volkes selbst aus eigenem Bewusstsein […] und auch aus eigenem Verständnis sich die Waffen zu ihrer eigenen Befreiung schmiedet« (GW 2, 465). Im Resultat »produziert nicht der M die Revolution, sondern die Revolution produziert den M«; wobei auch die Revolution nicht als ein einziger Akt, sondern als eine »Periode« (Mass, 130) gedacht ist.
4. Luxemburgs Darstellung der russischen Revolution von 1905, wie eine Reportage geschrieben, macht nachvollziehbar, weder M noch Revolution geschehen nach einem Plan aus einem Zentrum, sondern der Zusammenfl uss aus einzelnen Bewegungen, die selbst gegenteilig verlaufen können, macht aus ökonomisch beginnenden Streiks politische und umgekehrt. Die russische Sozialdemokratie, »die die Revolution zwar mitmacht, aber nicht ›macht‹«, muss die Gesetze, gemäß denen »die Geschichte« ihre »unberechenbare Riesenarbeit« (Mass, 112) vollbringt, selbst lernen. Luxemburg spricht vom Klassengefühl, das sich in Klassenbewusstsein verwandelt, und wie Marx und später Bertolt Brecht nimmt sie an, dass die Ordnung zu stürzen zugleich ein Destruktionsprozess wie der einer Neuordnung ist. Es geht um eine »gänzliche Unterwühlung des gesellschaftlichen Bodens, das Unterste muss nach oben, das Oberste nach unten gekehrt, die scheinbare
›Ordnung‹ in ein Chaos und aus dem scheinbaren ›anarchischen‹ Chaos eine neue Ordnung geschaffen werden« (113f). Mit welchem Pathos, welcher Sorgfalt sie die unterschiedlichen Momente zusammenführt, gibt zugleich Auskunft über ihre Theorie vom M und wie sie die Umsetzung in praktische Politik fasst: »Alle tausendfältigen Leiden des modernen Proletariats erinnern es an alte, blutende Wunden. Hier wird um den Achtstundentag gekämpft, dort gegen die Akkordarbeit, hier werden brutale Meister auf einem Handkarren im Sack ›hinausgeführt‹, anderswo gegen infame Strafsysteme, überall um bessere Löhne, hier und da um Abschaffung der Heimarbeit gekämpft. Rückständige, degradierte Berufe in großen Städten, kleine Provinzstädte, die bis dahin in einem idyllischen Schlaf dahindämmerten, das Dorf mit seinem Vermächtnis aus dem Leibeigentum – alles das besinnt sich plötzlich, vom Januarblitz geweckt, auf seine Rechte und sucht nun fieberhaft, das Versäumte nachzuholen.« (112)
Im November 1918 beschreibt Luxemburg die in Deutschland in Gang gekommene Bewegung: »Die Revolution […] betritt selbst die Bühne der Geschehnisse. […] Daher die fieberhaften Bemühungen der abhängigen Gewerkschaftsführer, den heraufziehenden Orkan in die Netze ihrer alten bürokratisch instanzlichen Mittelchen zu fangen und die Masse zu lähmen und zu fesseln«, doch müssten sie in der »Periode der Revolution […] elend versagen« (GW 4, 420). Sie erinnert, dass »jede bürgerliche Revolution der Neuzeit […] von einer stürmischen Streikbewegung begleitet [war]« (ebd.), wenn auch nach einer Phase des Ungleichgewichts eine Befestigung der bürgerlichen Klassenherrschaft folgte. Bei der Novemberrevolution von 1918 aber handele es sich um eine »Generalauseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit« (421). Sie irrt tragisch. Es bleibt der Gedanke, dass es eines Funkens bedarf, um die allgemeine Erkenntnis der lange erfahrenen Lage auszulösen und die Hoffnung auf die Befreiungsperspektive zu wecken. Gebraucht werden, dies ihre Richtschnur: Schulung, Klassenbewusstsein und Organisation.
Insgesamt stellt Luxemburg den M in den Entwicklungsprozess des Proletariats, wobei sie darunter auch die Staatsangestellten, die Heim- und die Landarbeiter, die Unorganisierten fasst (Mass, 137ff u. 143), und gibt der Debatte um M zugleich den Charakter eines unnützen Schauspiels – ähnlich wie dies später Brecht im Streit der Philosophen um die Existenz oder Nichtexistenz des Gelben Flusses vorführt, die vom über die Ufer tretenden Fluss fortgeschwemmt werden, bevor sie die Frage entscheiden können (Turandot, GW 5, 2211f). Luxemburg prüft die Entwicklung von Sozialdemokratie und Gewerk
schaften und bemerkt, dass das schnelle Wachstum der Gewerkschaften sich auch deren »Werbekraft« verdanke, die den gewerkschaftlich Organisierten das Gefühl gibt, einer »Arbeiterpartei« anzugehören, sie also keine Doppelmitgliedschaft für nötig hielten (160), während die »gewerkschaftlichen Leiter« nicht von der Einheit der gewerkschaftlichen und sozialdemokratischen Bewegung ausgehen, sondern zu »Gewerkschaftsbeamten« werden und dem »Bürokratismus« anheimfallen (163). So habe »sich der eigenartige Zustand herausgebildet, dass dieselbe Gewerkschaftsbewegung, die mit der Sozialdemokratie unten, in der breiten proletarischen Masse, vollständig eins ist, oben, in dem Verwaltungsüberbau, von der Sozialdemokratie schroff abspringt und sich ihr gegenüber als eine unabhängige zweite Großmacht aufrichtet« (167). Die notwendige Wiedervereinigung begreift sie als Verwandlung der Leitung in »Dolmetscher des Massenwillens« (170), die für den M Voraussetzung ist.
Luxemburg diskutiert, wie die großen Demonstrationen um die Wahlrechtsreform in Preußen durchaus Erfolge verzeichnen (Aufnahme von sieben Sozialdemokraten, darunter Karl Liebknecht, 1908 ins Abgeordnetenhaus), dass aber diese Massenbewegung unbedingt durch die Partei zu weiteren Aktionen geführt und erweitert werden müsse. Die »Straßendemonstrationen « genügen »bald nicht mehr dem psychologischen Bedürfnis, der Kampfstimmung, der Erbitterung der Massen, und wenn die Sozialdemokratie nicht entschlossen einen Schritt weiter tut, wenn sie den richtigen politischen Moment sich entgehen lässt […], so dürfte es ihr kaum gelingen, die Straßendemonstrationen noch eine längere Zeit hindurch aufrechtzuerhalten, die Aktion wird dann schließlich einschlafen« (GW 2, 292). Sobald ein Kampfmittel »ein Bedürfnis des demokratischen Bürgertums« geworden sei, müssten die Sozialdemokraten ein schärferes Mittel wählen: »es ist dies der M« (293).
So klar die Befreiungskräfte im historischen Prozess bestimmt werden, so wenig gilt Luxemburgs Analyse den Gegenkräften, sei es in Gestalt der Belohnungen für die arbeitende Bevölkerung oder v.a. der sich entwickelnden Strategien der herrschenden Klasse durch die Massenmedien, durch die verschiedenen Institutionen bis hin zum Zwang, die allesamt dem erkennenden Befreiungsverlangen entgegenarbeiten. Nach der Zustimmung zu den Kriegskrediten 1914 durch die sozialdemokratische Fraktion und die darauffolgende Verwandlung von Aufklärung und Information in den sozialdemokratischen Medien in Aufhetzung zu nationalistischer »Vaterlandsverteidigung « analysiert sie Fehler und Irrtum v.a. in den eigenen Reihen und kommt insgesamt zum Ergebnis, dass die Bürokratisierung bekämpft werden müsse. Ihre Ermordung macht eine weitere Ausarbeitung zunichte. Festzuhalten bleibt, dass sie aufs Verändern beim Machen setzt und also auf die Einbeziehung der Vielen in die Gestaltung von Gesellschaft, somit wie Marx und Gramsci darauf, dass die Selbstveränderung und die Veränderung der Umstände in revolutionärer Aktion zusammenfallen. Im »Auf und Ab« der Resultate aus den verschiedenen Streiks und der »Racheakte des Kapitalismus« bleibe als »geistiger Niederschlag: das sprungweise intellektuelle, kulturelle Wachstum des Proletariats« (Mass, 117) und die Entwicklung des Kapitalismus selbst als »die ›Zivilisierung‹ der barbarischen Formen der kapitalistischen Ausbeutung« (149).
Frigga Haug
II.
Mit der Welle revolutionärer Kämpfe, die von den russischen Revolutionen 1917 ihren Ausgang nahmen und den europäischen Kontinent bis 1923 in Atem hielten, kam es zu einer Serie von M.s, die mehr oder weniger spontan begannen und radikale, revolutionäre Veränderungen herbeiführen wollten. Waren diese Streiks eine »Erscheinungsform des proletarischen Kampfes in der Revolution« (Mass, 125), wie Rosa Luxemburg diagnostiziert? Was waren die Bedingungen ihres Scheiterns?
1. Russland 1917: Vom M zur Revolution. – Zum Internationalen Frauentag, der nach dem russischen Kalender auf den 23. Februar 1917 fiel, hatten die sozialistischen Untergrundgruppen des Zarenreichs zu Protesten, nicht aber zu Streiks aufgerufen. Dennoch traten Petrograder Textilarbeiterinnen aus Wut über die zunehmende Nahrungsmittelknappheit spontan in den Ausstand, der sich rasch auf weitere Fabriken in der Stadt ausbreitete. Bereits am nächsten Tag erfasste er große Teile der Arbeiterschaft Petrograds, die in großen Demonstrationszügen ins Stadtzentrum marschierten. Die Forderung nach Brot wurde ergänzt durch Forderungen wie »Nieder mit der Selbstherrschaft« und »Nieder mit dem Krieg«. Bald stießen die Streikenden mit der Staatsgewalt zusammen. Nach vier Tagen M und Massendemonstrationen begannen Einheiten von Polizei und Armee sich mit der Arbeiterschaft zu solidarisieren. Die Bewegung erfasste auch andere Städte und zwang den Zar am 3. März zur Abdankung. Eine spontane, sich an der Versorgungslage entzündende Streikbewegung war binnen weniger Tage in einen politischen M umgeschlagen, der die zaristische Selbstherrschaft stürzte – eine Entwicklung, die für die sozialistischen Parteien nicht weniger überraschend kam wie für die Herrschenden.
Ähnlich wie in der Revolution von 1905 entstanden aus den M.s wieder Sowjets (Räte) als Organe einer proletarischen Demokratie, Teil einer Doppelherrschaft aus den Räten auf der einen und der zunächst von bürgerlichen, dann von reformerisch-sozialistischen Kräften gestellten provisorischen Regierung auf der anderen Seite. In den kommenden Monaten und v.a. ab Spätsommer 1917 breitete sich erneut eine M-Welle über das Land aus, vorangetrieben von den Bolschewiki mit den Forderungen nach »Land, Brot und Frieden« sowie »Alle Macht den Räten«. Als Ende August ein konterrevolutionärer Putsch gegen die provisorische Regierung begann, antwortete die Arbeiterschaft mit neuen Streiks, bis der Putsch nach wenigen Tagen zusammenbrach. Weitere Streikbewegungen und Besetzungen von Fabriken und Ländereien bewirkten, zusammen mit der massenhaften Desertion von Soldaten, eine grundlegende Verschiebung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse zugunsten der zunehmend aufständischen Massen. Nicht durch einen spontanen Aufstand, sondern auf dem Wege eines bis ins Einzelne vorbereiteten Umsturzes übersetzten die Bolschewiki die veränderten Kräfteverhältnisse am 25. Oktober in den Staatsapparat und verlagerten die Macht in den Kongress der Arbeiter-, Soldaten- und Bauernsowjets. Durch Mandat des Kongresses ermächtigt, übernahm am folgenden Tag der neu gebildete Rat der Volkskommissare die Regierungsarbeit.
2. Januarstreiks in Österreich-Ungarn und Deutschland 1918. – Neue Hoffnung ging von den revolutionären Ereignissen in Russland aus und ermutigte die Arbeiter anderer Länder zu entschiedeneren Protesten gegen den Krieg. Unterm Eindruck der sowjetischen Friedensinitiative und des enttäuschenden Verlaufs der Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk beteiligten sich zwischen dem 3. und 25. Januar 1918 über 700 000 Arbeiter an Antikriegsstreiks in Österreich-Ungarn, die wiederum den Anstoß gaben für den größten M in Deutschland während des Ersten Weltkriegs (Opel 1957/1980, 71). An der einwöchigen Streikbewegung, die sich gegen eine Weiterführung des Kriegs und die Annexionsbestrebungen gegenüber Sowjetrussland richtete, nahmen fast eine Million Menschen teil. Allein in Berlin waren es am 28. Januar, dem ersten Streiktag, rund 400 000 Streikende (Luban 2008/2015, 21). Weder Gewerkschaften noch Arbeiterparteien organisierten diese M-Bewegung, sondern die Delegierten aus den Betrieben (Abendroth 1985/1997, 158). Sie stützten sich auf Facharbeiter, Gewerkschaftsmitglieder und viele Frauen. Die Betriebsobleute (Vertrauensleute) des Deutschen Metallarbeiter-Verbands (DMV) bildeten von unten und in Opposition zum DMV -Vorstand die Streikleitung, den »Arbeiterrat Groß- Berlin«. Sie standen der kriegsoppositionellen USPD nahe, ließen sich aber die Streikführung nicht aus der Hand nehmen. Vertreter von USPD und SPD wurden in die Streikleitung kooptiert. Diese hatten nur beratende Stimme und sollten den politischen Streik in beiden Parteien absichern. Als die Regierung direkte Gespräche mit den Obleuten verweigerte und stattdessen Beratungen mit Reichstagsabgeordneten und Mitgliedern der Generalkommission der Gewerkschaften anbot, lehnte die Streikleitung solche stellvertretenden Verhandlungen kategorisch ab und beschloss – auch in diesem Moment unabhängig von Gewerkschaftsleitungen und Parteien – die geordnete Wiederaufnahme der Arbeit am 4. Februar. »Die Politikform der Obleute war der politische M« (Hoffrogge 2008/2015, 55), ergänzt um das Mittel der Demonstration auf Grundlage einer lebendigen Versammlungsdemokratie.
3. Novemberrevolution. – Der Unmut in der Arbeiterschaft gärte weiter, und als ab Ende Oktober 1918 eine Revolte der Matrosen der Hochseefl otte von Kiel aus ihren Ausgang nahm, fanden sie Unterstützung durch spontane Streikbewegungen, die sich über das ganze Reich ausbreiteten, während es in Berlin zunächst noch ruhig blieb. Am 4. November brach der Generalstreik der Kieler Werft- und Rüstungsarbeiter die Macht der kaiserlichen Regierung in Schleswig-Holstein. In München und Leipzig siegte die Revolution am 7. und 8. November im Zuge von Arbeiter- und Soldatendemonstrationen und örtlichen Generalstreiks. Am 9. November begann der Generalstreik in Berlin. Wieder lagen Vorbereitung und Organisation bei den Obleuten der Betriebe der Metall- und Elektroindustrie, die Waffenlager angelegt hatten. Vor allem war es ihnen durch Agitation in den Kasernen gelungen, die Truppen in der Stadt für sich zu gewinnen. Die streikenden Belegschaften verließen die Betriebe und zogen ins Stadtzentrum. Besonders die Ereignisse in Berlin veranlassten Arthur Rosenberg, in den M.s vom Januar die »Generalprobe für die Novemberrevolution « zu sehen (1955, 187).
Hier zeigte sich, dass es zwar nicht möglich ist, einen Generalstreik einfach zu beschließen, dass es aber in gesellschaftlich extrem zugespitzten Situationen durchaus der Initiative entschlossener Revolutionäre bedarf, um über den Zeitpunkt des Handelns zu entscheiden. Wochenlang stritt man um den Termin des Generalstreiks, der den Aufstand auslösen sollte. Zunächst auf den 4. November festgelegt, dann auf den 11. November verschoben, rief die Leitung der Obleute gemeinsam mit der Spartakusgruppe schließlich am Abend des 8. November zum berlinweiten Generalstreik für den folgenden Tag auf und konstituierte sich zugleich als »provisorischer Arbeiterrat von Groß-Berlin«. Begleitet von teilweise bewaffneten proletarischen Demonstrationszügen, denen sich auch immer mehr Soldaten und Polizisten anschlossen, erzwang dieser Generalstreik tatsächlich die Flucht des Kaisers und mündete in der doppelten Ausrufung der Republik als »deutsche« (Philipp Scheidemann, SPD) bzw. »freie sozialistische« (Karl Liebknecht, USPD). Gegen den Willen der SPD setzten die Obleute, gestützt auf ihre Basis in den Betrieben und die Erwartungen der Streikenden, eine Revolutionsregierung durch, die nur von den sozialdemokratischen Parteien gebildet wurde (»Arbeiter-Regierung«). Die von General Erich Ludendorff und anderen führenden Militärs seit 1917 betriebene »Revolution von oben«, in die die Gewerkschaftsvorstände bis zuletzt ihre Hoffnung gesetzt hatten, konnte die »Revolution von unten« erst einmal nicht verhindern (Opel 1957/1980, 75).
Obwohl der Übergang zu einer sozialistischen Revolution auch an der Politik der SPD scheiterte, ging der Kampf um politische Reformen doch mit dem um soziale Reformen einher, und in der Folge der Novemberrevolution konnten der Achtstundentag, das allgemeine Wahlrecht für Frauen und Männer, die Tarifautonomie und Betriebsräte durchgesetzt werden. Wie von Luxemburg prognostiziert, hatte sich der M als »ein Mittel, erst die Bedingungen des täglichen politischen Kampfes und insbesondere des Parlamentarismus für das Proletariat zu schaffen« (Mass, 96), erwiesen. Allerdings blieb die Lage der demokratischen Republik prekär, und viele Hoffnungen auf weitergehende Sozialreformen und Sozialisierungen wurden enttäuscht.
4. Kapp-Putsch 1920: Generalstreik gegen Rechts. – Gegen die Revolutionsbewegung und den linken Flügel der Arbeiterbewegung war die SPD einen »Pakt mit den alten Mächten«, mit dem Militär und dem monarchistisch geprägten Staatsapparat, eingegangen (v.a. Friedrich Ebert und Gustav Noske) und hatte sich an der Niederschlagung der Räterepubliken in der ersten Jahreshälfte 1919 beteiligt. Im März 1920 unternahm nun ein Teil der monarchistischen Reaktion mit dem hohen preußischen Beamten Wolfgang Kapp und dem General Walther von Lüttwitz an der Spitze einen Staatsstreich gegen die junge Republik. Die Reichsregierung stand dem Putsch ohnmächtig gegenüber. Der Militärapparat, auf den sie sich im Kampf gegen Links gestützt hatte, versagte ihr im Kampf gegen Rechts die Gefolgschaft: »Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr« lautete die lapidare Antwort des Oberkommandierenden General Hans von Seeckt auf die Bitte der Regierung um Unterstützung.
Militärisch schien der Putsch zu Beginn erfolgreich. Spontan und überwältigend war jedoch die zivile politische Antwort der Arbeiterschaft, die im größten Generalstreik der deutschen Geschichte mit etwa 12 Mio Beteiligten kulminierte. Zunächst von den freien Gewerkschaften (sozialdemokratische Arbeiter- und Angestelltengewerkschaften), der SPD und der USPD ausgerufen, griff er in Windeseile von Berlin auf weitere Städte über und legte bald das ganze Land lahm. Die christlichen Gewerkschaften, die KPD und der sozialdemokratische Beamtenbund schlossen sich später an. Der Generalstreik zielte dabei nicht auf die bloße Wiederherstellung der zuvor bestehenden Macht- und Regierungsverhältnisse, sondern auf eine Demokratisierung von Staat und Wirtschaft und entschiedene Sozialisierungsmaßnahmen zur Abwehr aller restaurativen Tendenzen. Im Streik entwickelte sich eine radikalisierende Dynamik bis hin zu bewaffneten Aufständen. Die Arbeiter griffen monarchistische Armeeeinheiten an und bildeten die »Rote Ruhrarmee«, die zeitweilig das gesamte Ruhrgebiet kontrollierte. Ähnlich wie 1918/19 entstanden lokale Räte. Unter der Wucht des Generalstreiks brach der Putsch nach wenigen Tagen zusammen. Die freien Gewerkschaften setzten den Generalstreik auch nach dem Rücktritt Kapps fort, um entschiedene Maßnahmen gegen die radikale Rechte, eine Demokratisierung der Verwaltung und Sozialisierungsmaßnahmen durchzusetzen. Sie verlangten, namentlich Carl Legien (ADGB-Vorsitzender/ SPD) und Robert Dissmann (DMVVorsitzender/ USPD), die Bildung einer Regierung aus allen sozialistischen Parteien und boten dieser die außerparlamentarische Absicherung durch die Gewerkschaften an. Dieser Vorschlag scheiterte (Opel 1957/1980, 117). Nachdem die Regierungsparteien den Gewerkschaften kleinere Zugeständnisse gemacht hatten, erklärten diese am 20. März den Generalstreik für beendet. Die angestrebte grundlegende Umgestaltung der Weimarer Republik und v.a. eine Demokratisierung von Militär und Beamtenschaft wurden nicht erreicht. Bald brach die Regierung ihre Versprechen und setzte Anfang April eben jene Reichswehr, die dem Putsch überwiegend positiv gegenübergestanden hatte, zur Eroberung des Ruhrgebiets samt Niederschlagung der lokalen Rätemacht und der »Roten Ruhrarmee« ein. Der Generalstreik gegen den Kapp-Putsch veranschaulicht die Dynamik einer sich an einer politischen Existenzfrage entzündenden M-Bewegung, die umschlägt in eine Bewegung für tiefgreifende Strukturreformen. Unterm Druck der zunächst spontanen Streiks hatten die Gewerkschaftsführungen etwas getan, was sie jahrelang bekämpft hatten, nämlich zum Generalstreik aufgerufen. Sie beanspruchten ein gesellschaftspolitisches Mandat – die Rettung und den Ausbau der demokratischen Republik – und stellten sich erfolgreich an die Spitze einer politischen Massenaktion. Sie scheiterten an den Antagonismen innerhalb der USPD und zwischen SPD und USPD. Im März 1920 erwies sich der M als »die mächtigste Waffe des politischen Kampfes um politische Rechte« (Luxemburg, Mass, 97), als diese reaktionär bedroht waren. Aber das weitergehende Potenzial des größten Generalstreiks der deutschen Geschichte zu einer sozialen Demokratisierung der Weimarer Republik blieb letztlich ungenutzt, ein Versäumnis, für das die gesamte Arbeiterschaft 1933 den Preis zahlen musste.
5. Die Märzaktion der KPD 1921: Der M lässt sich nicht verordnen. – In der revolutionären Welle zwischen 1917 und 1923 bewahrheitete sich die luxemburgsche Annahme des M als Bewegungsform der proletarischen Revolution nicht nur in Russland und Deutschland, sondern ebenso bei der von M.s begleiteten ungarischen Räterepublik 1919 oder den massenhaften Fabrikbesetzungen der italienischen »roten Jahre« 1920/21. Manche ihrer Annahmen bestätigten sich auch als richtige Vorhersagen negativer Folgen. So musste die – eben erst durch ihre Vereinigung mit dem linken Flügel der USPD zur Massenpartei gewordene – KPD bei ihrer Märzaktion 1921 die bittere Erfahrung machen, dass sich ein M auch dann nicht verordnen lässt, wenn er von einer gerade erstarkten kommunistischen Partei ausgeht. Nachdem sie beim M gegen den Kapp-Putsch zunächst eine eher passive Haltung eingenommen hatte, da sie eine Verteidigung der sozialdemokratisch regierten Republik ablehnte, brannte sie nun darauf, dieses Versäumnis durch offensive Aktionen zu kompensieren.
Ihr Versuch, im März 1921 unter Fehleinschätzung der Kräfteverhältnisse im Reich eine lokale Auseinandersetzung in Mitteldeutschland zu einem aufständischen nationalen Generalstreik zu verallgemeinern, scheiterte kläglich und führte zu Festnahmen, Massenaustritten und einer vorübergehenden Isolierung der Kommunisten. Der M ist kein »bloßes technisches Kampfmittel […], das nach Belieben […] ›beschlossen‹ oder auch ›verboten‹ werden kann« (Mass, 98) – dieser Satz Luxemburgs galt für reformistische Gewerkschaftsfunktionäre nicht weniger als für revolutionäre Parteikommunisten. Die selbstkritische Auseinandersetzung mit den Ereignissen führte bei KPD und KI zu einer strategischen Neuausrichtung: der Einheitsfrontpolitik als Grundform einer revolutionären Realpolitik in nichtrevolutionären Zeiten. Bis 1924 wurden Initiativen zur Aktionseinheit der verschiedenen Arbeiterorganisationen sowie zur systematischen Arbeit in den reformistischen Gewerkschaften ein hoher Stellenwert eingeräumt. Auf dieser Grundlage gelang der KPD ihre Konsolidierung als Massenpartei, die 1923 noch einmal den Griff nach der Macht wagen konnte.
6. Deutscher Oktober 1923. – Im Herbst 1923 erwies sich Luxemburgs Annahme vom M als Bewegungsform der proletarischen Revolution in der Umkehrung als zutreffend: ohne M keine Revolution. Die tiefe Krise, in der sich Deutschland seit dem Ende des Weltkriegs befunden hatte, erreichte 1923 ihren letzten Höhepunkt. Die französische Besetzung des Rheinlands und eine atemberaubende Hyperinflation erschütterten die gesellschaftliche Ordnung. Die Gesellschaft geriet in einen Zustand des zunehmenden Verfalls, die sozialen Konflikte nahmen zu. Bereits im Mai hatte Deutschland die größten Landarbeiterstreiks seiner bisherigen Geschichte erlebt. Anfang Juni streikten die Bergarbeiter Oberschlesiens. An der Küste traten die Seeleute in den Ausstand. Anfang Juli legten über 100 000 Berliner Metallarbeiter die Arbeit nieder. In den großen Städten griffen Teuerungsunruhen um sich und Erwerbslosendemonstrationen nahmen zu. Kommunisten waren an allen diesen Bewegungen beteiligt und spielten in ihnen oft eine führende Rolle. Selbst bürgerliche Politiker wie Gustav Stresemann sahen: »Wir tanzen auf einem Vulkan, und wir stehen vor einer Revolution, wenn wir nicht durch eine ebenso entschlossene wie kluge Politik die Gegensätze versöhnen können.« (Zit.n.Wenzel 2003, 150)
Die KPD profitierte von der Situation. Ihr Einfluss in den Gewerkschaften wuchs spürbar. Die Partei schien auf dem besten Wege, die Mehrheit der Arbeiterklasse für sich zu gewinnen (vgl. Rosenberg 1955, 406f), und als die Krise im August 1923 weiter eskalierte, schien die Revolution vielen Kommunisten endlich in Reichweite. Im August zwang ein stark von der KPD beeinflusster lokaler Generalstreik in Berlin, bei dem Betriebsräteversammlungen radikale Forderungen bis hin zu der nach einer »Arbeiter und Bauernregierung« beschlossen, die Regierung von Reichskanzler Wilhelm Cuno zum Rücktritt. »Es hat nie in der neueren deutschen Geschichte einen Zeitabschnitt gegeben, der für eine sozialistische Revolution so günstig gewesen wäre wie der Sommer 1923« (Rosenberg 1955, 405). Unterm Eindruck des Desasters des vorschnellen und isolierten Aufstandsversuchs der Märzaktion 1921 machte die KPD allerdings einen Rückzieher. Statt die Dynamik voranzutreiben und die Revolution aus realen Kämpfen (Streiks) zu entwickeln, setzte die KPD-Führung auf einen mit sowjetischer Hilfe minutiös vorbereiteten Aufstand, der im Herbst 1923 stattfinden sollte. Sein Kernstück sollte ein landesweiter Generalstreik sein, den die Kommunisten gemeinsam mit dem linken Flügel der SPD und der Gewerkschaften zu proklamieren hofften. Um die Vorbereitungen nicht zu gefährden, tendierten die Kommunisten zur Zurückhaltung hinsichtlich weiterer Streikbewegungen im Frühherbst. Die Konsolidierung der neuen Reichsregierung unter Stresemann, an der die SPD beteiligt war, machte den Kommunisten jedoch einen Strich durch die Rechnung.
Im Herbst übernahmen ›Arbeiterregierung‹ genannte Koalitionen aus KPD und SPD die Regierungen in Sachsen und Thüringen. Sie sollten als Sprungbrett zum Aufstand fungieren. Die Reichsregierung entsandte Truppen, was nach den Planungen der KPD den Anlass zu einem reichsweiten Aufstand bieten sollte, für dessen Auftakt die Ausrufung eines Generalstreiks durch eine parteiübergreifende Betriebsräteversammlung in Chemnitz vorgesehen war. Im ganzen Land fieberten die Kommunisten dem Aufruf entgegen, wie die Erinnerungen der Aktivistin Rosa Meyer-Leviné an eine kommunistische Versammlung in Frankfurt am Main am entscheidenden 21. Oktober veranschaulichen: »Der Saal war berstend voll, die Erregung groß. Wir harrten des Signals, das den Generalstreik ausrief. […] Während wir fiebernd auf das ›Signal‹ warteten, tagte ein Kongress der Betriebsräte«, der letztlich »nur den Mut [fand], seine tragische Unfähigkeit zu entdecken und einzugestehen – und zum Rückzug zu blasen« (1977/1982, 65f). Die sozialdemokratisch organisierte Mehrheit der Betriebsräte verweigerte sich einem Aufruf zum Generalstreik, und sein Ausbleiben ließ die kommunistischen Aufstandspläne zusammenbrechen. Nur in Hamburg kam es zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Kommunisten und der Polizei, in denen letztere die Oberhand behielt. Ohne M war die Revolution im Herbst 1923 jedoch zum Scheitern verurteilt. Das Ausbleiben des ›Deutschen Oktober‹ wurde zu einem Ereignis von weltgeschichtlicher Bedeutung: Mit ihm endeten die Hoffnungen auf eine baldige Ausweitung der Revolution nach Westen und zementierte sich die Isolation der SU, auf die bald der Aufstieg des Stalinismus mit seiner Theorie des »Sozialismus in einem Land« folgen sollte.
7. Weltwirtschaftskrise und Hitlers Machteinsetzung: Ohne M in die Katastrophe. – In der ab 1924 einsetzenden Prosperität kam es zu keinen weiteren M-Bewegungen, und das explosionsartige Ansteigen der Arbeitslosigkeit nach Ausbruch der Weltwirtschaftskrise 1929 schwächte die Arbeiterbewegung und wirkte ausgreifenden Streikbewegungen entgegen. Schwer wog aber auch der subjektive Faktor: Die Weltwirtschaftskrise und der auf sie folgende, kometenhafte Aufstieg der NSDAP trafen auf eine KPD, die sich im Zuge ihrer Stalinisierung von der Einheitsfrontpolitik abgewandt hatte. Statt zur Aktionseinheit aufzurufen, dominierte die pauschale Beschimpfung der SPD als »sozialfaschistisch«; statt in den Allgemeinen Gewerkschaften systematisch zu arbeiten, verfolgte die KPD eine Politik der Spaltung und des Aufbaus einer eigenen, »Revolutionären Gewerkschafts-Opposition«. Obwohl Wähler- und Mitgliederzahlen der KPD stiegen, ging ihre hegemoniale Ausstrahlung zurück. Mit der wachsenden Feindschaft innerhalb der Arbeiterbewegung schwand deren Fähigkeit, konkrete Erfolge zu erkämpfen und wirksame Strategien im Kampf gegen Kapitalismus und Faschismus zu entwickeln. Als Hitler 1933 als Reichskanzler eingesetzt wurde, traf er auf keinerlei dem Generalstreik gegen den Kapp- Putsch 1920 vergleichbare Reaktion der Arbeiterbewegung. Der M kam nicht zur Anwendung. Es hatte in den Jahren zuvor auch kaum Streiks und soziale Kämpfe gegeben, aus denen sich eine M-Dynamik hätte entfalten können. Isolierte Generalstreikaufrufe der KPD nach der Regierungsübernahme Hitlers verpufften.
Das durch M eröffnete Kapitel einer demokratischen Republik in Deutschland wurde auch aufgrund der Unfähigkeit der Arbeiterbewegung, mittels M die Abwälzung der Krisenkosten auf Arbeiterschaft und Kleinbürgertum abzuwehren und sich dadurch als glaubwürdige Alternative zum Faschismus zu präsentieren, mit einer einschneidenden Niederlage der linken und der Arbeiterbewegung geschlossen.
Florian Wilde, Frank Heidenreich
Bibliographie: W.Abendroth, Einführung in die Geschichte der Arbeiterbewegung. Von den Anfängen bis 1933 (1985), 3., durchges. A., Heilbronn 1997; Ch.Boebel u. L.Wentzel (Hg.), Streiken gegen den Krieg. Die Bedeutung der Massenstreiks in der Metallindustrie vom Januar 1918 (2008), 2., durchges. A., Hamburg 2015; R.Hoffrogge, »Hinter den Kulissen des Januarstreiks 1918. Richard Müller und die Revolutionären Obleute«, in: Boebel/Wentzel 2008/2015, 51-66; O.Luban, »Die Massenstreiks für Frieden und Demokratie im Ersten Weltkrieg«, in: Boebel/Wentzel 2008/2015, 11-26; R.Meyer-Leviné, Im inneren Kreis. Erinnerungen einer Kommunistin in Deutschland 1920-1933 (1977), hgg. u. eingel. v. H.Weber, a.d. Engl. v. B.Bortfeld, Frankfurt/M 1982; F.Opel, Der Deutsche Metallarbeiter-Verband während des Ersten Weltkrieges und der Revolution (1957), 4.A., Köln 1980; A.Rosenberg, Entstehung und Geschichte der Weimarer Republik, hgg. v. K.Kersten, Frankfurt/M 1955; O.Wenzel, 1923. Die gescheiterte Deutsche Oktoberrevolution, Einl. v. M.Wilke, Münster 2003.